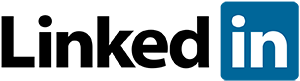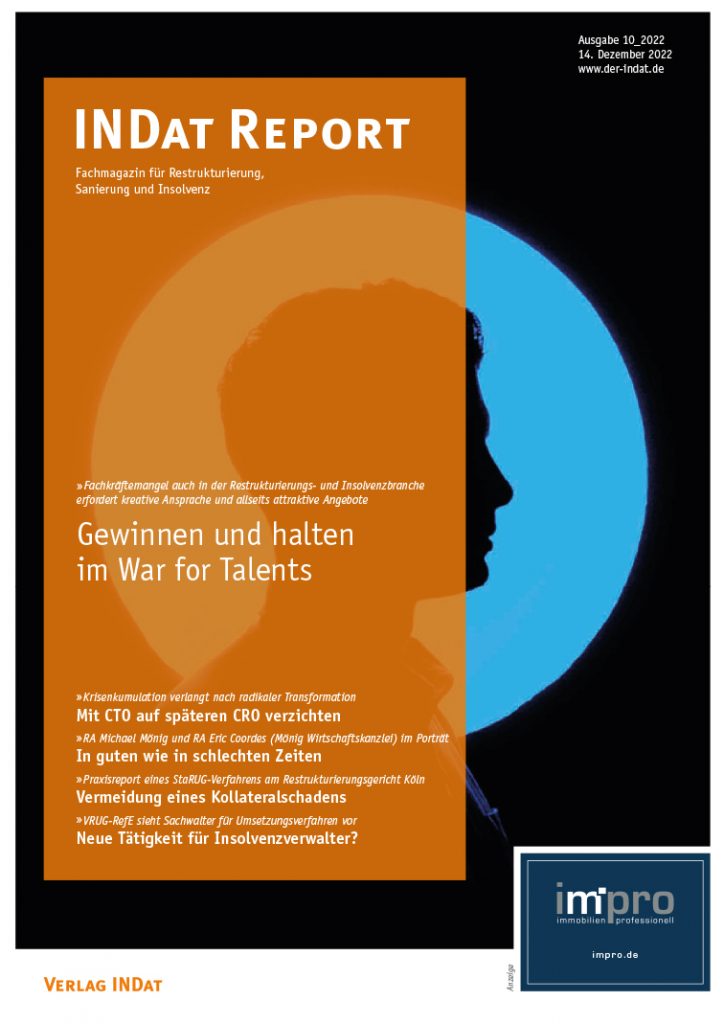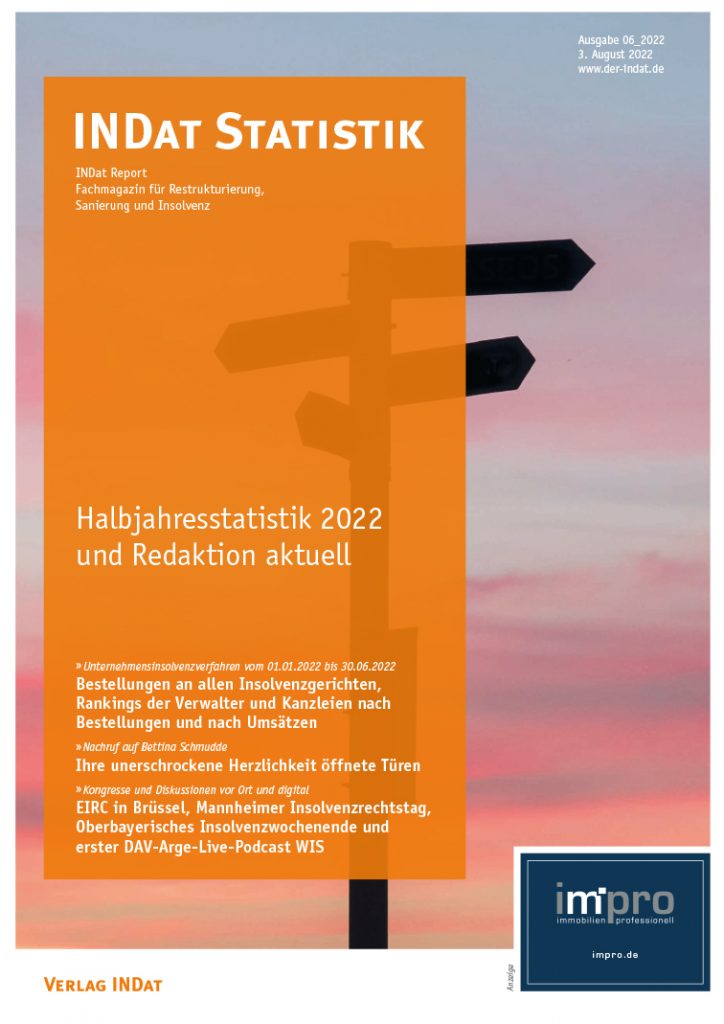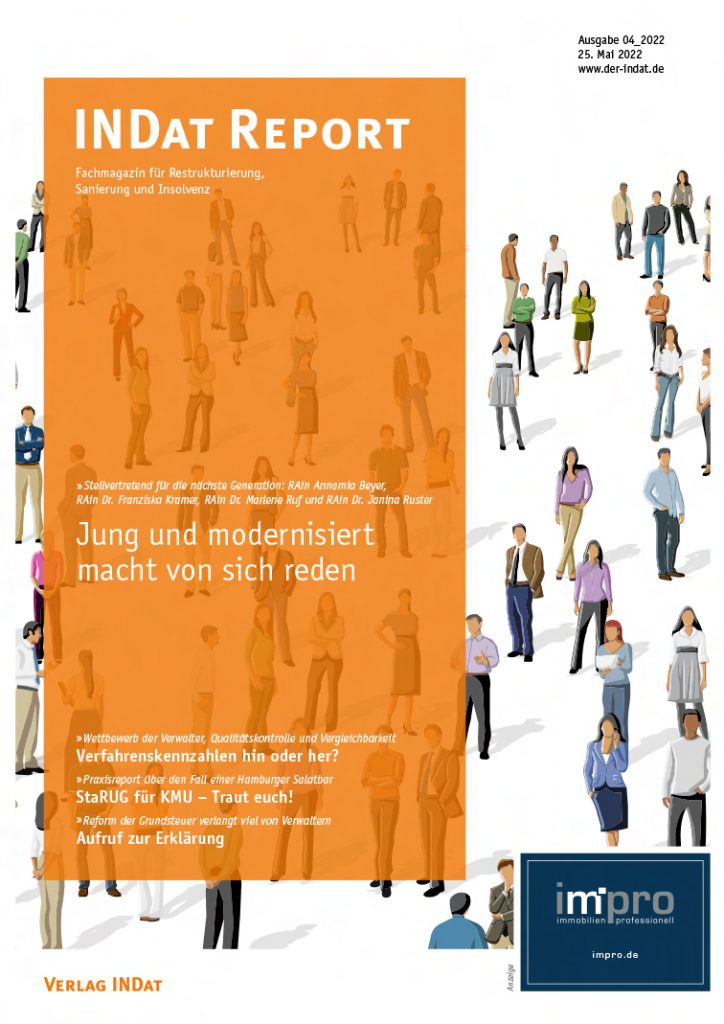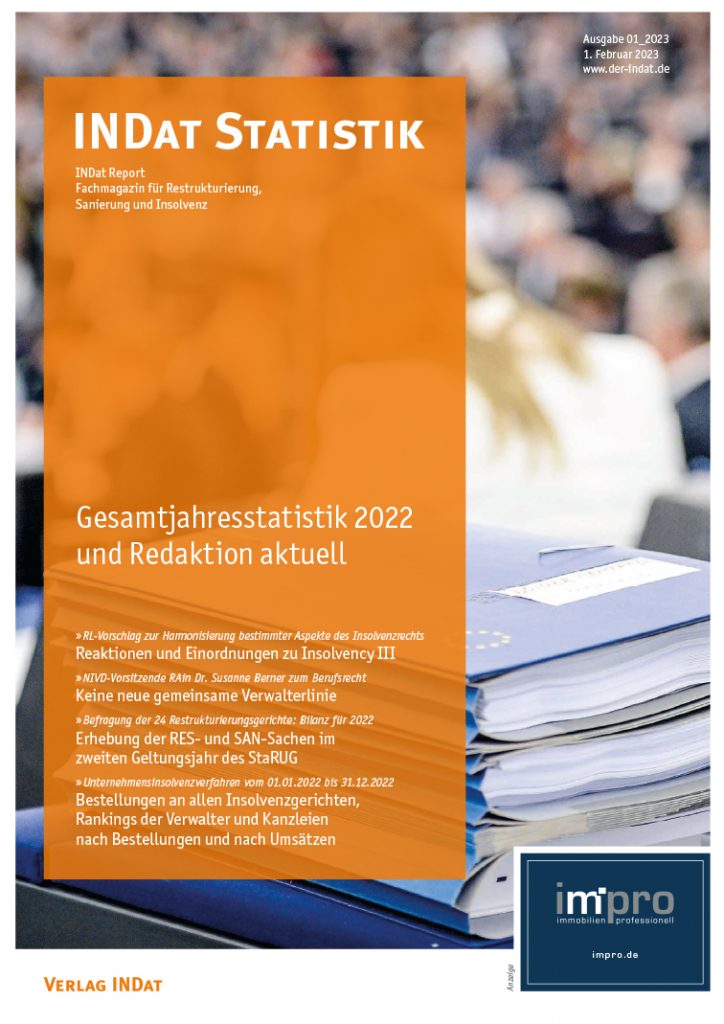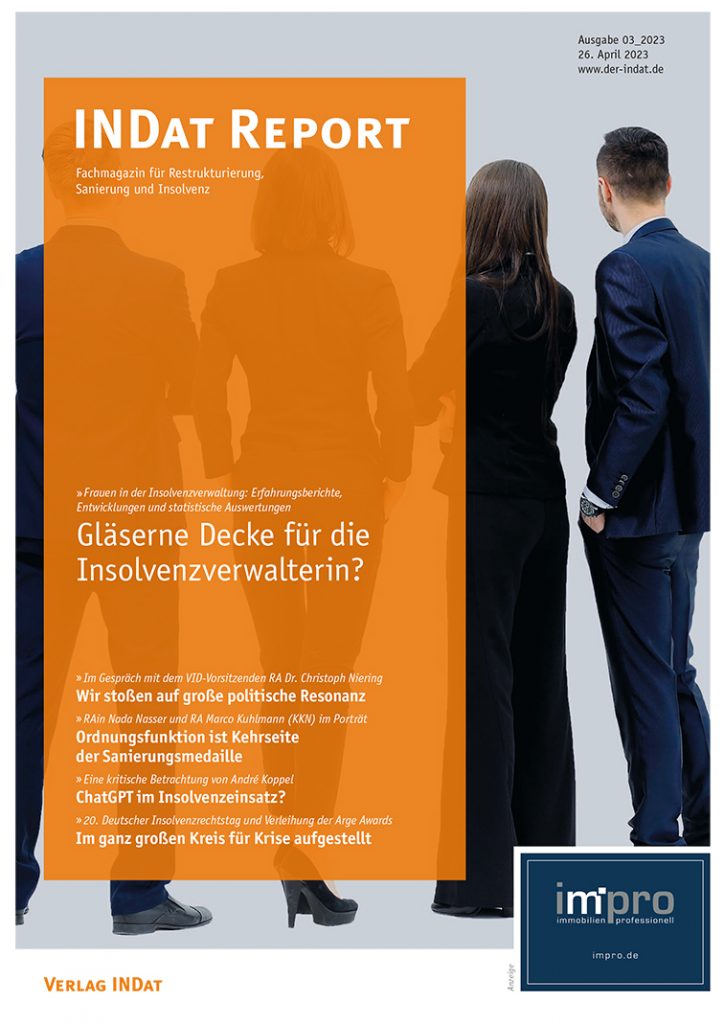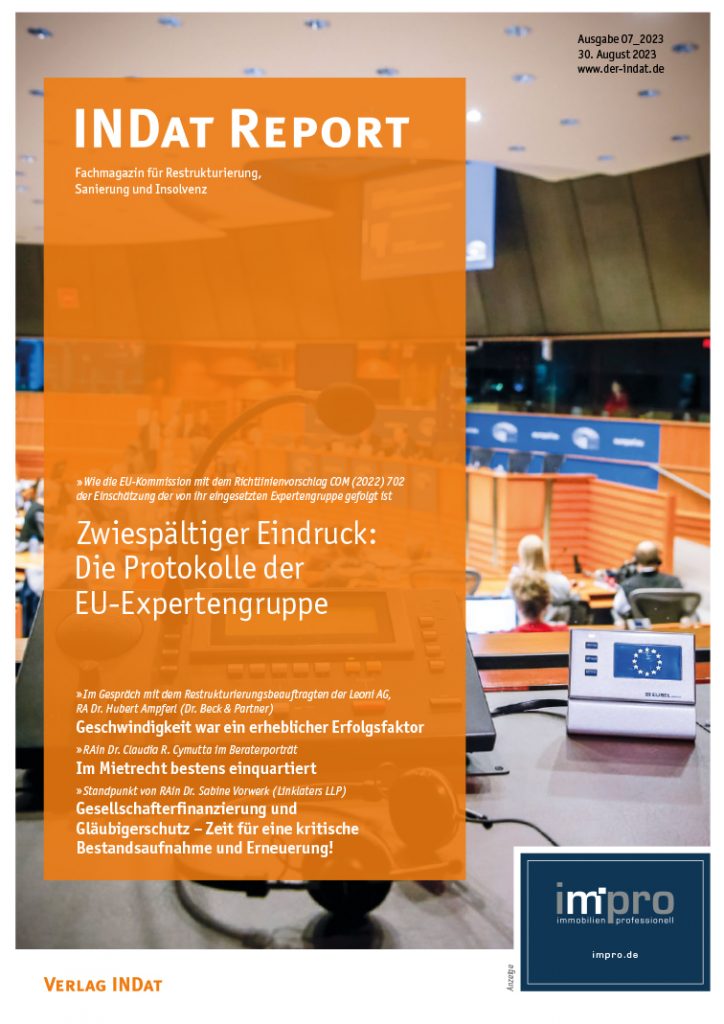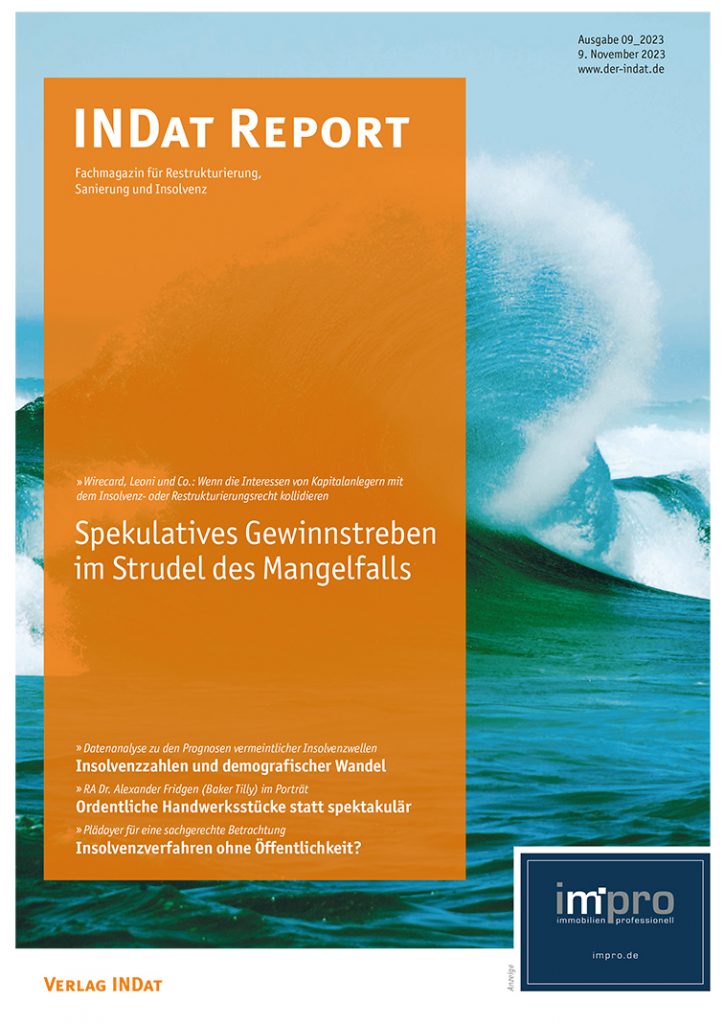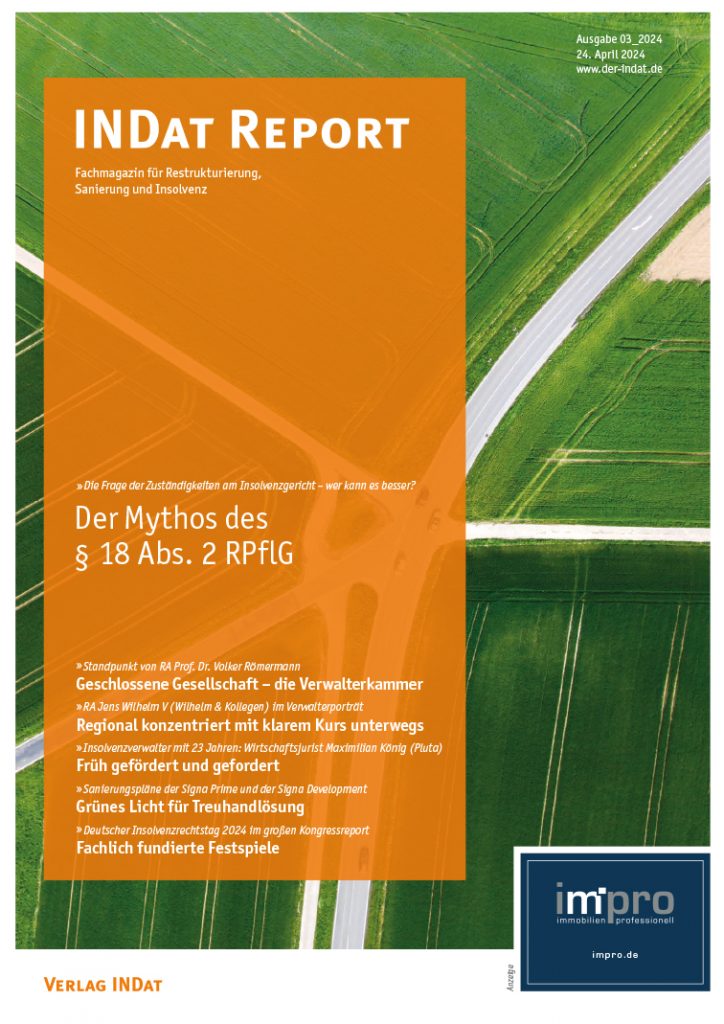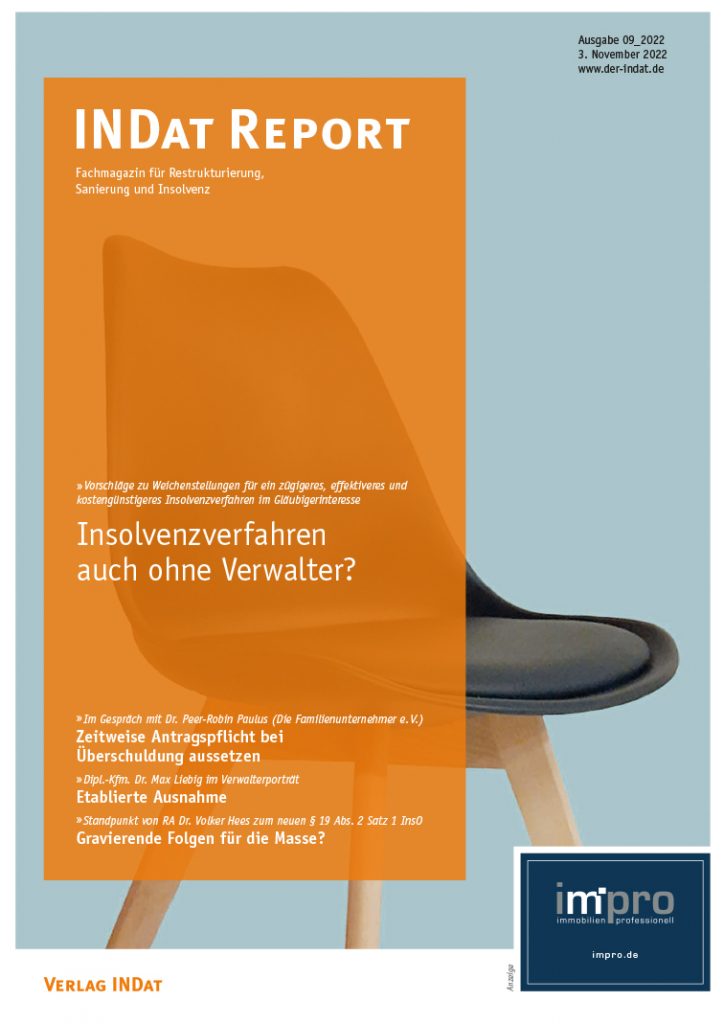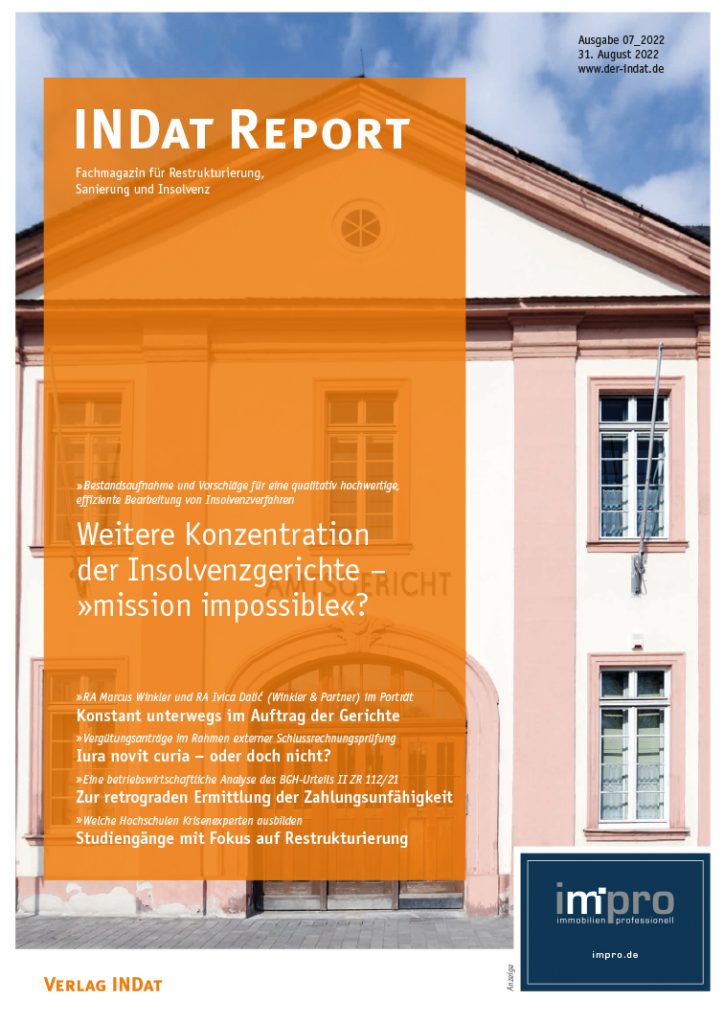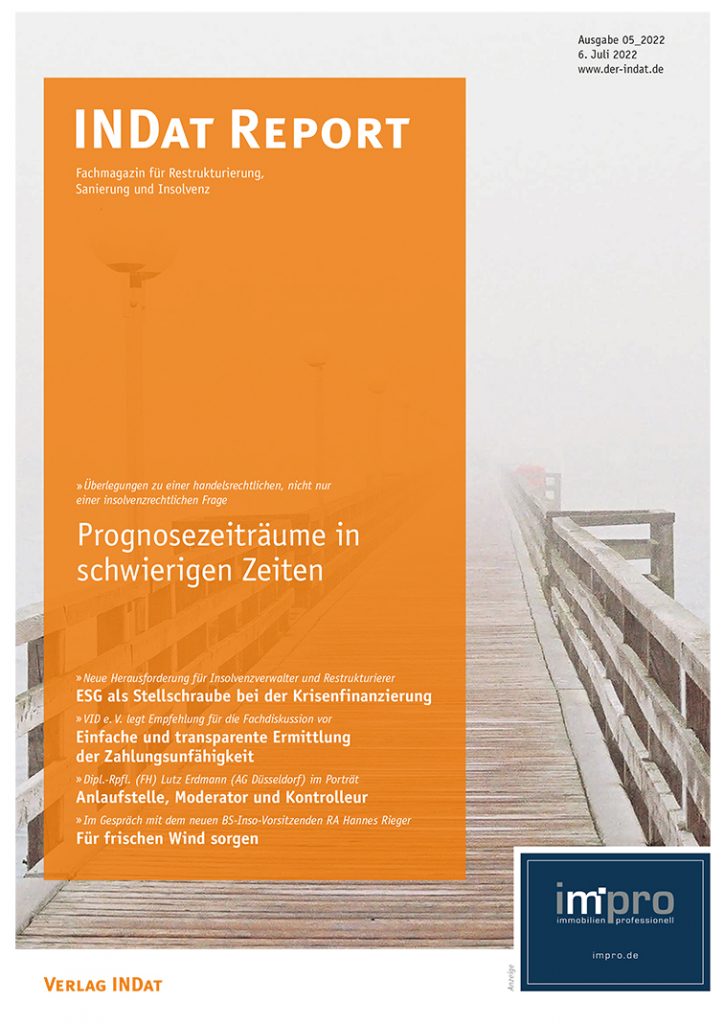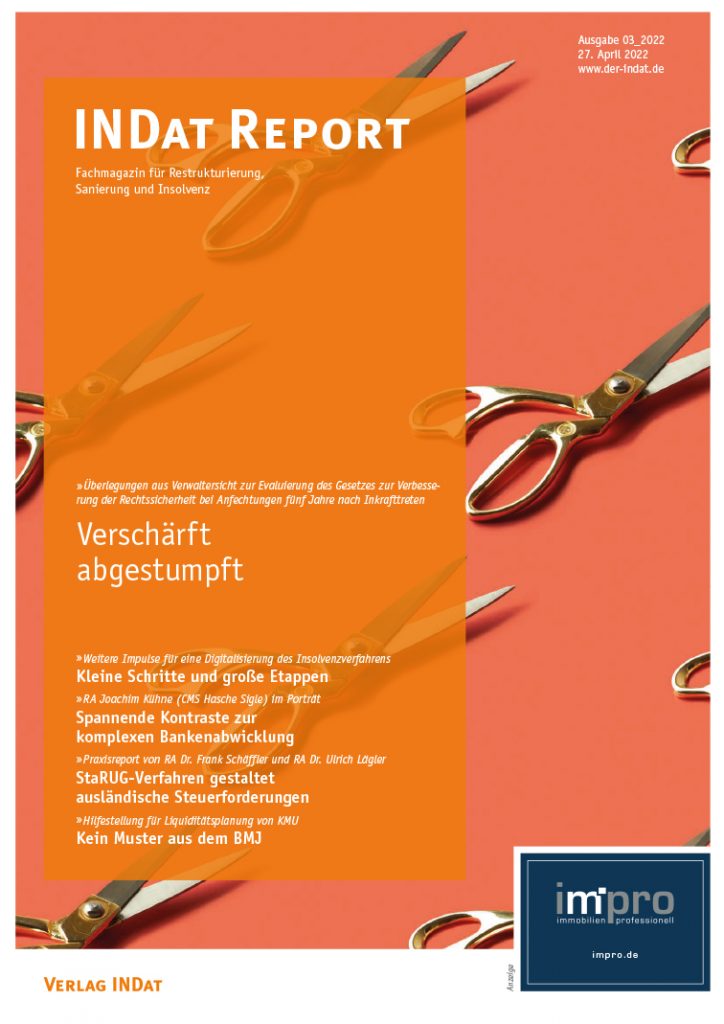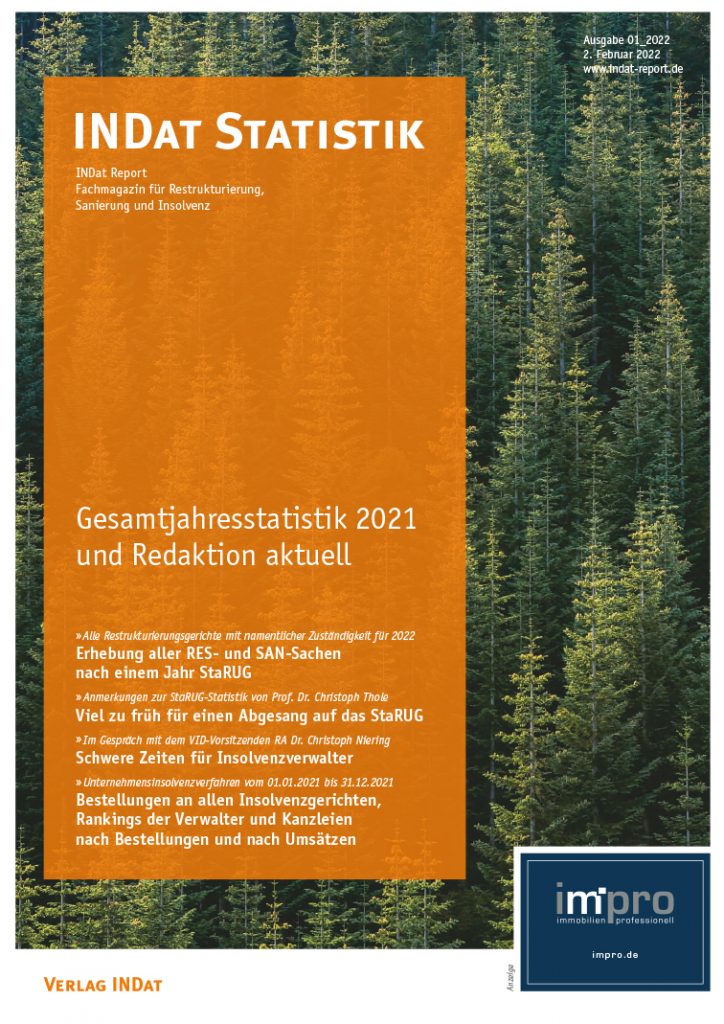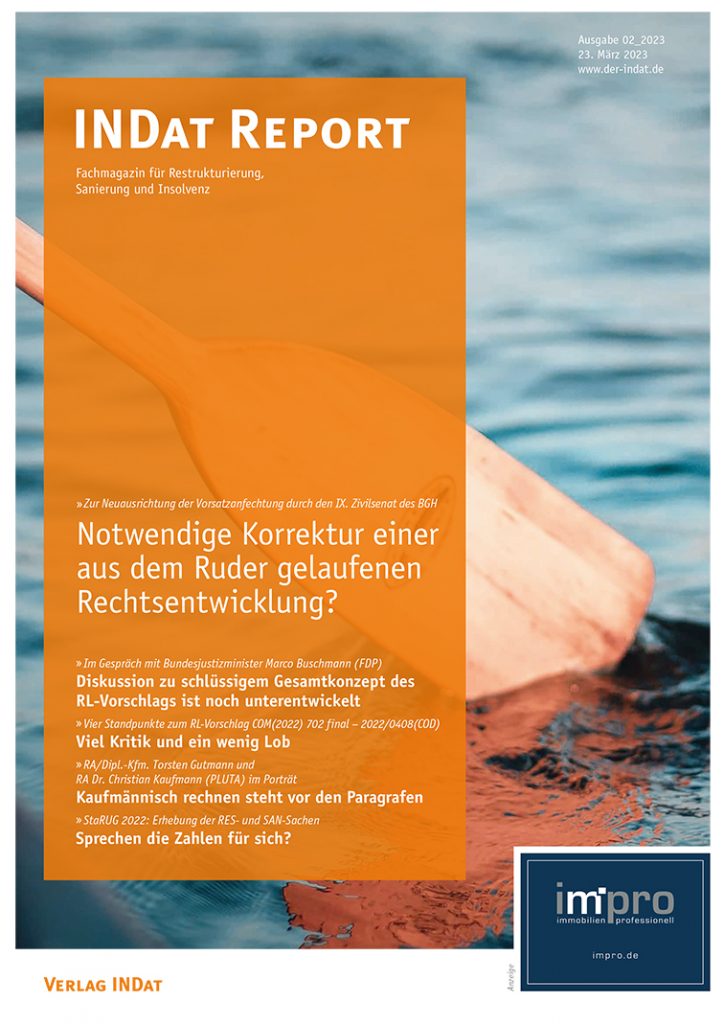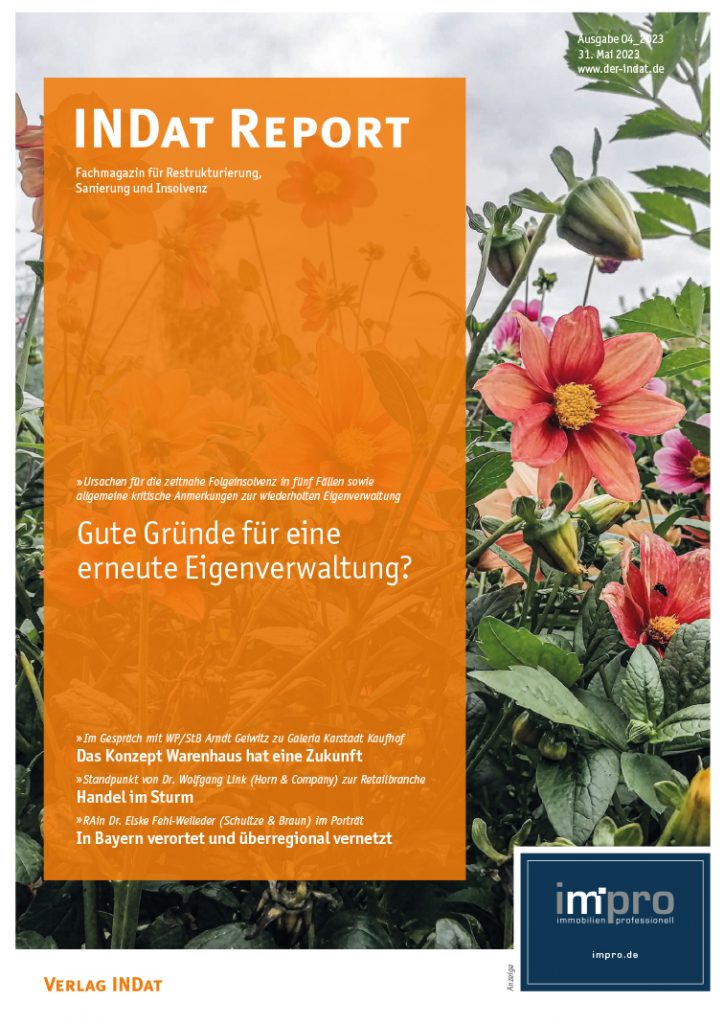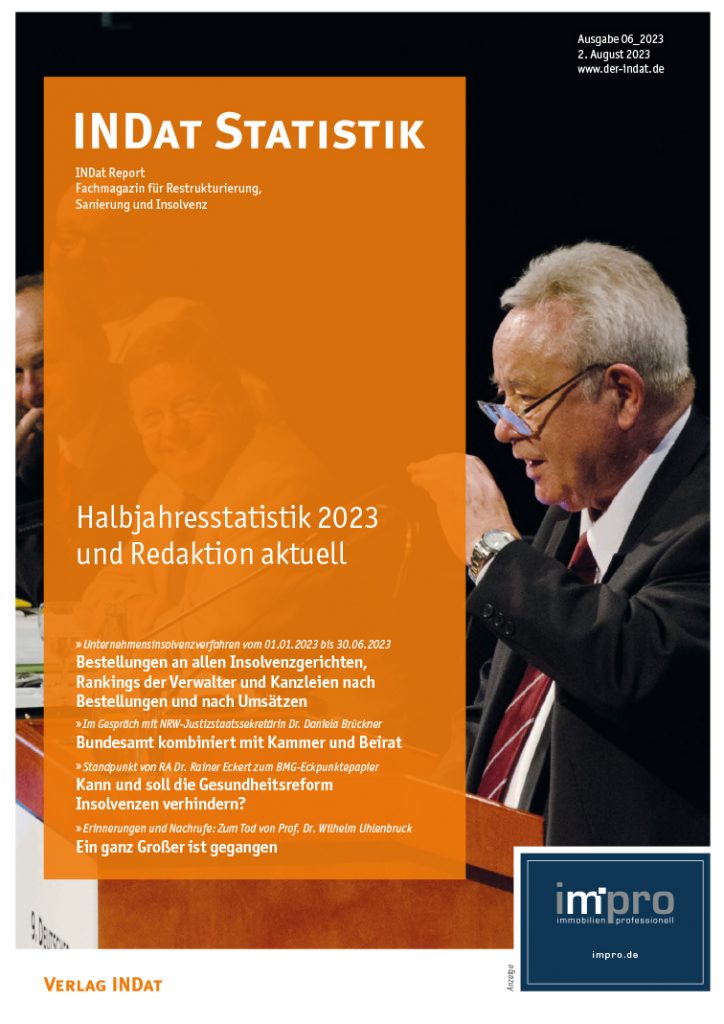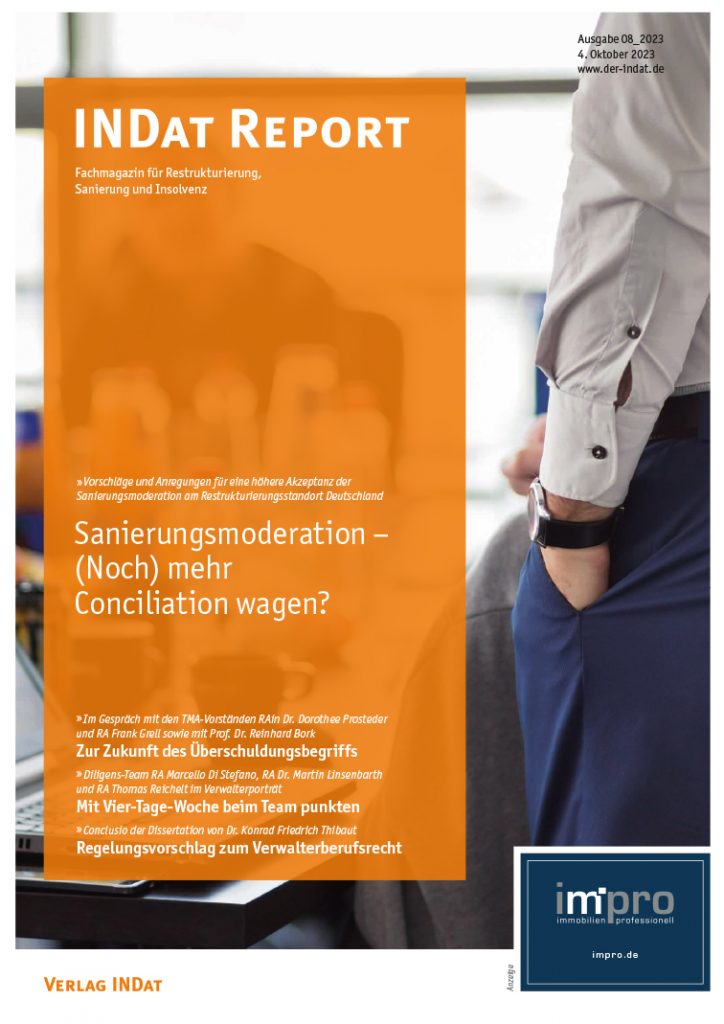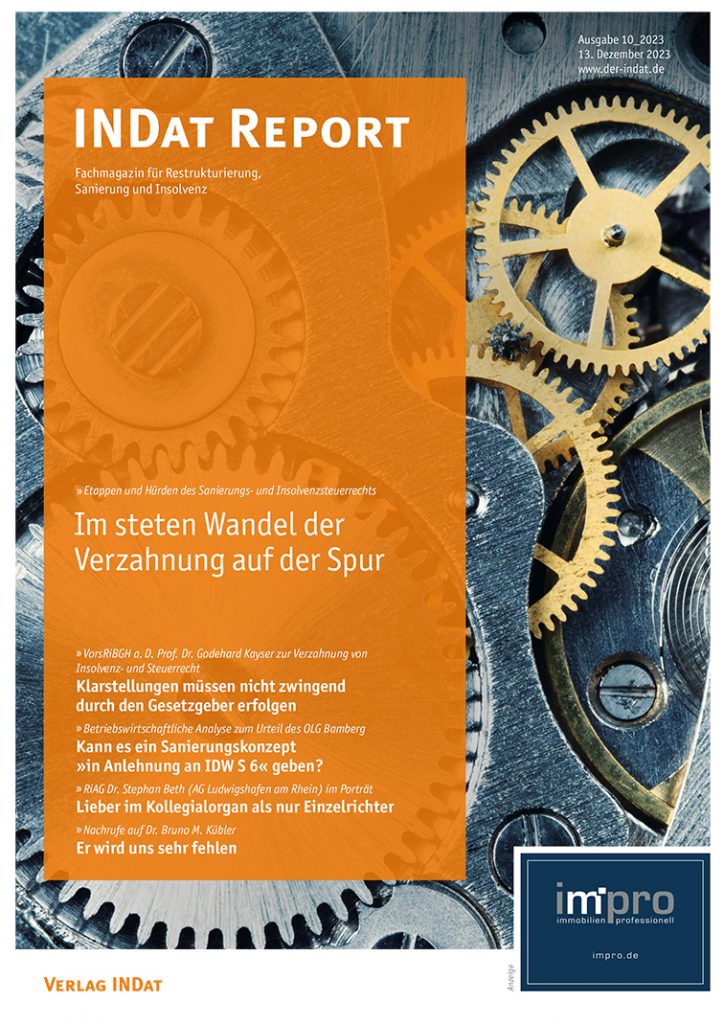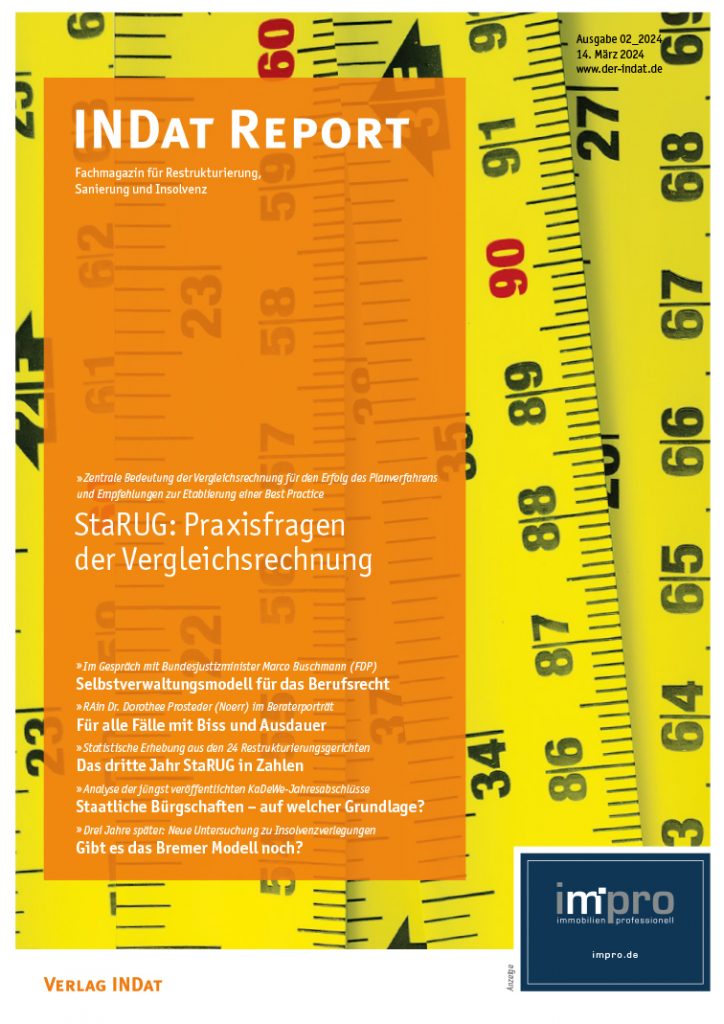Titel | INDat Report 05_2024 | Juli 2024
Nachgefragt bei den Berichterstattern zum Insolvenzrecht der Fraktionen CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im Deutschen Bundestag
Insolvenzrecht pragmatisch politisch betrachtet
Berlin. Wenn insolvenzrechtliche Reformen, Neuerungen oder Änderungen zur Debatte stehen, gehören die Berichterstatter für das Insolvenzrecht zu den zentralen Figuren für die Meinungsbildung in ihren Fraktionen. Zu aktuellen Themen dieser Legislaturperiode haben Sascha Woltersdorf und Peter Reuter vier Rechtspolitiker mit dieser Aufgabe befragt: von der CDU/CSU-Fraktion Stephan Mayer, von der SPD Esra Limbacher, von Bündnis 90/Die Grünen Dr. Till Steffen und von der FDP Judith Skudelny, die bereits schon in zwei vorherigen Legislaturperioden Berichterstatterin für das Insolvenzrecht ihrer Fraktion war, ihre drei Kollegen üben diese Funktion zum ersten Mal aus.
Die vier MdB standen Rede und Antwort zur Zukunft des Überschuldungsbegriffs, zur weiteren Digitalisierung der Justiz im Kontext des Restrukturierungs- und Insolvenzverfahrens, zum Richtlinienentwurf zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts, zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds und zur Schutzlücke des Bestellers im Fall der Insolvenz des Bauträgers. Auch äußerten sich die vier Berichterstatter dazu, ob sie die Initiative des Verbands Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands e. V. (VID) schon erreicht hat, das Insolvenzverwaltervergütungsrecht in einem neu zu schaffenden Gesetz zu reformieren, und wie sie sich dazu positionieren. Nicht nur politische Statements, sondern auch fachliche Ausführungen waren erwünscht, wenngleich es sich zugegebenermaßen um eine sehr spezielle Materie für Rechtspolitiker handelt.
Mit dem RefE zu einem Verwalterberufsrecht und dem Evaluationsbericht des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens konnte der INDat Report die Berichterstatter der Fraktionen zum Insolvenzrecht noch nicht konfrontieren. Der entsprechende Entwurf bzw. Bericht des Bundesjustizministeriums an den Deutschen Bundestag lagen noch nicht vor.
INDat Report: Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat kürzlich in einem 18-seitigen Papier auf Anfrage von (nicht genannten) Mitgliedern des Bundestages bzw. einer Fraktion erörtert, ob es zur Verhinderung einer Insolvenzwelle versorgungsrelevanter Krankenhäuser verfassungsrechtlich zulässig sei, nur für die Krankenhausbetriebe im Rahmen der insolvenzrechtlichen Überschuldung nach § 19 InsO den Prognosezeitraum der Fortbestehensprognose von zwölf auf vier Monate zu verkürzen, was für alle Unternehmen gem. SanInsKG bis 31.12.2023 gegolten hatte. Der Wissenschaftliche Dienst kommt zu dem Schluss, dass sich der Regelungs- und Gestaltungsspielraum dafür in den verfassungsrechtlichen Grenzen bewegen dürfte. Wie beurteilen Sie einen möglichen Ausnahmetatbestand im Insolvenzrecht für einen bestimmten Wirtschaftssektor und wäre es ggf. – wie von Stimmen aus der Wirtschaft vertreten – nicht angezeigt, wie in anderen Jurisdiktionen generell auf den Überschuldungsbegriff zu verzichten?
Esra Limbacher (SPD): Ich teile die Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes. Insbesondere wäre eine derartig ausgestaltete Ausnahmeregelung am Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG zu messen. Der Gesetzgeber müsste daher eine sachliche Rechtfertigung für diese Differenzierung finden. Meines Erachtens läge diese für die Krankenhäuser etwa in der besonderen Versorgungsrelevanz der Krankenhäuser für die Allgemeinheit. Darüber hinaus müsste der Eingriff in die bestehende Insolvenzordnung durch eine Verkürzung des Prognosezeitraums verhältnismäßig sein. Es müsste nachgewiesen werden, dass diese Maßnahme tatsächlich geeignet, erforderlich und angemessen ist, um die beabsichtigte Wirkung – die Verhinderung einer Insolvenzwelle bei versorgungsrelevanten Krankenhäusern – zu erzielen. Die Maßnahme müsste auch verhältnismäßig sein im engeren Sinne, d. h., sie darf die betroffenen Unternehmen nicht übermäßig belasten und muss dem Ziel angemessen sein. Die Auswirkungen auf Gläubiger und andere Stakeholder wären zu berücksichtigen. Ich bin insofern davon überzeugt, dass eine derart gestaltete Ausnahme verfassungsrechtlich zulässig wäre. Ein gänzlicher Verzicht auf den Überschuldungsbegriff im Insolvenzrecht erfordert eine hinlängliche differenzierte ökonomische und juristische Betrachtung. Es würde sich die Flexibilität der Unternehmen erhöhen, sich selbst zu sanieren, bevor man sofort in die Insolvenz gezwungen wird. Gerade in aktuellen oder folgenden Krisenzeiten könnten mehr Unternehmen überleben, was zu einer Stabilisierung der Wirtschaft beiträgt.
Stephan Mayer (CDU/CSU): Die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages benennt klar die relevanten Grenzen der abstrakten Aussagefähigkeit ohne Vorliegen eines konkreten Gesetzgebungsvorschlags und zeigt gleichzeitig inhaltlich-konzeptionelle Zielkonflikte und Beweggründe auf. Es ist wichtig, die Dinge im Kontext zu betrachten. Die Verkürzung des Prognosezeitraums der Fortbestehensprognose von zwölf auf vier Monate gem. SanInsKG bis 31.12.2023 ist im Kontext der unternehmens- und sektorübergreifenden und global verheerenden Auswirkungen der Pandemie zu begreifen. Durch Verkürzung des Referenzzeitraums hat dieser Baustein zum Abbau von Unsicherheit in einer Zeit beigetragen, in welcher Risiken nicht quantifizierbar waren. In Zeiten funktionierender marktwirtschaftlicher Aktivität, in welcher unternehmerische Risiken der Liquidität quantifizierbar sind, mag eine Verkürzung nicht notwendigerweise das Risiko mindern und eine Insolvenz unwahrscheinlicher erscheinen lassen. Der Eröffnungsgrund eines Insolvenzverfahrens und der Insolvenzantragspflicht bei haftungsbeschränkten Rechtsträgern aufgrund von Überschuldung gem. § 19 InsO ist ein zentrales Element des präventiven Gläubigerschutzes und meiner Ansicht nach so essenziell, dass es nicht ohne eine äquivalente Regelung ersatzlos gestrichen werden sollte. Einer Ausnahme für einen gesamten Wirtschaftszweig qua Definition oder Zugehörigkeit stehe ich skeptisch gegenüber. Die Wesentlichkeit einer Relevanz für die öffentliche Daseinsvorsorge, verstanden als systemische Relevanz in der Vorhaltung kritischer Funktionen, mag bei Krankenhäusern nicht selten gegeben sein. Dies mag aber regional und betreffend die angebotenen Leistungen durchaus unterschiedlich sein und bedarf daher einer individuellen Begründetheit. Ein Rechtsvergleich: Das Vorhalten kritischer Infrastruktur wird im Rahmen eines Public Interest Assessments bei individuellen Kreditinstituten beurteilt und dient der Entscheidung, ob eine Behandlung des Unternehmens im Rahmen einer Liquidation oder aufgrund von systemischer Relevanz im Rahmen einer Abwicklung sachdienlich ist.
(…)
Inhalt
Die kommende Ausgabe INDat Report 06_2024 erscheint am 31.07.2024.
Am 10.07.2024 ist Anzeigenschluss, alle weiteren Termine finden Sie auf www.der-indat.de.
Aktuelle Ausgabe: 10.07.2024
Umfang: 74 Seiten
Berater & Kanzleien
Begleitung mit idealem Tool und Timing

Hans Konrad Schenk
Dienstleister & Spezialisten (Heft 04_2024)
Auf Datenspuren zur Massemehrung

Pink Wirtschaftsprüfung GmbH